
| Autoren | Glossen | Lyrik |
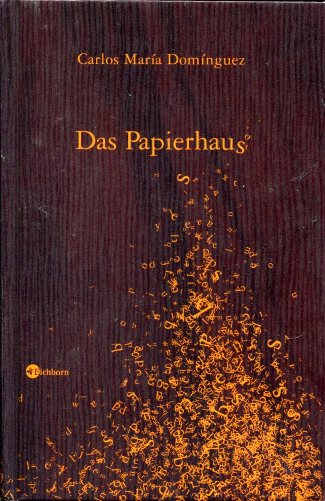 Carlos Maria Dominguez
Carlos Maria Dominguez
Das Papierhaus.
Aus dem Spanischen von Elisabeth Müller
Eichborn Verlag 2004, 93 Seiten
ISBN 3-8218-5730-7
Bluma Lennon, Professorin für Literatur an der Universität Cambridge, überquert eine Straße, vertieft in die Lyrik Emily Dickinsons. Dabei wird sie von einem Auto erfasst und tödlich verletzt. Der Erzähler soll sie vertreten bis die Nachfolgefrage geklärt ist. Kurz danach wird ein Päckchen für Bluma geliefert, das der Erzähler öffnet. Es enthält eine Ausgabe von Joseph Conrads "Die Schattenlinie" (1946 bei Emecé in Buenos Aires in der Reihe La puerta de marfil [1] erschienen) mit einer Widmung Blumas an einen Carlos mit der Ortsangabe Monterrey. Kein Begleitschreiben, kein Absender, die Briefmarken weisen auf Uruguay. Das Buch ist in miserablem Zustand, Zementpartikel verkleben die Seiten.
Der Erzähler, der auch Blumas Liebhaber gewesen ist, möchte mehr über Carlos erfahren und beginnt Nachforschungen. In Monterrey hatte ein Kongress stattgefunden und in Blumas Aufzeichnungen stößt er auf die Namen zweier Teilnehmer, die er anschreibt; einer erwähnt einen Bibliophilen mit Namen Carlos Brauer, den er mit Bluma eines abends habe davon gehen sehen.
Als der Erzähler während der Semesterferien seine Mutter in Buenos Aires besucht, beschließt er, seine Nachforschungen in Uruguay fortzusetzen, er reist nach Montevideo. Der Antiquar Jorge Dinarli liefert ihm ein Psychogramm Brauers ("... passioniert und imstande, einen Haufen Geld für ein bestimmtes Buch auszugeben, um für Stunden darin zu versinken und nichts anderes zu tun, als es zu studieren und zu verstehen." [2]) und verweist ihn an Agustin Delgado, der Brauer viel näher gestanden habe als er selbst.
Delgado ist ein pedantischer Sammler [3], der Brauer als einen halt- und maßlosen Bibliomanen beschreibt, der sein gesamtes Geld für Bücher ausgegeben hat. Sein Haus quoll über von Büchern [4], der finanzielle Ruin war nicht mehr aufzuhalten. Nachdem ein Brand seinen umfangreichen und nach irrwitzigen Kriterien sortierten Katalog vernichtet, verkauft Brauer sein Haus und reist nach Mexiko. Dort – in Monterrey – nimmt er an einem Schriftstellerkongress teil, worüber er später Delgado berichtet: "Ich habe eine sehr hübsche englische Dozentin kennengelernt, das war das beste. Eine von diesen feurigen, von sich überzeugten Akademikerinnen, die für jede Lebenslage ein literarisches Zitat parat haben und sich, wenn ihnen ihr Stündlein schlägt, am liebsten Emily Dickinson lesend überfahren lassen würden." [5]
Später erfährt Delgado, dass Brauer in der Lagune von Rocha ein Grundstück gekauft hat, wohin er die ca. 20.000 Bände seiner Bibliothek liefern ließ, um sie als Material für ein Haus verbauen zu lassen.
Der Erzähler sucht ihn auch dort, findet aber nur noch die Ruine des Papierhauses vor, Brauer selbst ist spurlos verschwunden. Fischer, die der Erzähler befragt, berichten davon, dass Brauer eines Tages damit begonnen hatte, die Wände des Hauses mit einem schweren Hammer zu beschädigen. Offenbar auf der Suche nach einem ganz bestimmten Buch. Als er es schließlich gefunden hatte, verschwand er, keiner weiß wohin.
Dominguez [6] variiert die häufig unter Bibliophilen verwendete Phrase "Habent sua fata libelli" (Bücher haben ihre eigenen Schicksale) [7] gleich mehrfach: "Bücher verändern das Schicksal der Menschen" [8] und "Die Menschen verändern auch das Schicksal der Bücher" [9].
Die Reise des Erzählers wird auf einer ausklappbaren Karte auf Transparentpapier dargestellt, der Einband des Buches hat eine feine Holzstruktur, was die Lektüre auch haptisch zu einem Genuss macht.
Zitat: "Tatsache ist, daß letztlich der Umfang einer Bibliothek zählt. Wie ein riesiges offenes Gehirn wird diese nämlich unter fadenscheinigen Entschuldigungen und falscher Bescheidenheit zur Schau gestellt. Ich kannte mal einen Professor für klassische Philologie, der die Zubereitung des Kaffees in seiner Küche absichtlich in die Länge zog, um dem Gast Gelegenheit zu geben, seine Bücherregale zu bewundern. Erst wenn das geschehen war, kehrte er befriedigt lächelnd mit dem Tablett ins Wohnzimmer zurück.
Wir Leser spionieren die Bücherschränke unserer Freunde aus und sei es zur Ablenkung. Weil wir ein Buch entdecken könnten, das wir lesen wollen und nicht besitzen, oder weil wir einfach wissen wollen, was das Tier, das wir vor der Nase haben, in sich hineingefressen hat. Wenn wir einen Kollegen allein im Wohnzimmer sitzen lassen, steht er bei unserer Rückkehr garantiert vor dem Bücherregal und schnuppert darin herum." S. 17f
----------------------------
1. Herausgegeben von Borges und Bioy Casares
2. S. 26
3. "Diese Bücherwände hier sind aus Lapacho-Holz gefertigt, ein Holz, das weder Risse noch Spalten aufweist, so daß sich kein Ungeziefer einnisten kann. Die Regale sind eine Sonderanfertigung und bestehen aus zehn Hartholzschichten, mit einem insektenabweisenden Klebstoff verleimt. Ich habe sie mit Glastüren versehen, weil Bücher ja bekanntlich Staub anziehen. Ab und zu lasse ich sie trotzdem vorsorglich ausräuchern, man kann nie wissen." S. 38
4. "Irgendwann hatte er so viele Bücher – über zwanzigtausend, glaube ich –, daß er die Bücherregale in seinem keineswegs kleinen Wohnzimmer quer stellen mußte wie in einer öffentlichen Bücherei. Sogar im Bad standen an allen Wänden Bücher, und sie sind ihm nur deshalb erhalten geblieben, weil er kein warmes Wasser mehr laufen ließ, um den Dampf zu vermeiden. Er duschte kalt, im Sommer wie im Winter." S. 40
5. S. 60f
6. 1955 in Buenos Aires geboren, lebt seit 1989 in Montevideo. Schriftsteller, Journalist, Literaturkritiker.
7. Vollständig übrigens: Pro captu lectoris habent sua fata libelli (Je nach dem Verständnis des Lesers haben Bücher ihre eigenen Schicksale). (Aus: Terentianus Maurus (lateinischer Grammatiker, Ende des 2. Jahrhunderts) "De litteris, de syllabis, de metris.")
8. S. 7
9. S. 71
----------------------------
8. Januar 2021