
| Autoren | Glossen | Lyrik |
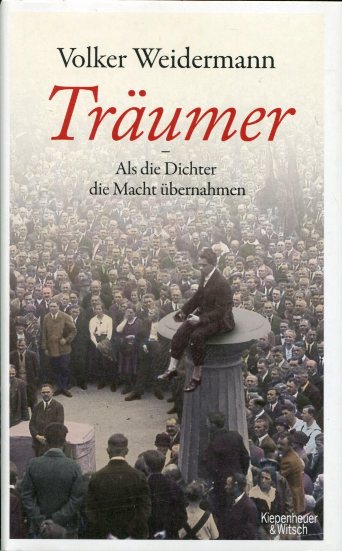 Volker Weidermann
Volker Weidermann
Träumer
Als die Dichter die Macht übernahmen
Kiepenheuer & Witsch 2017, 288 Seiten
ISBN 978-3-462-04714-1
Der Erste Weltkrieg liegt in den letzten Zügen, da versammeln sich am 7. November 2018 Zehntausende auf der Münchner Theresienwiese, um gegen den Krieg zu protestieren. Der Sozialdemokrat Erhard Auer versucht die Massen zu beruhigen, während an anderer Stelle Kurt Eisner zur Revolution aufruft. Ihm folgen die Massen als er von Kaserne zu Kaserne zieht, und die kriegsmüden Soldaten schließen sich ihm in großer Zahl an. Man versammelt sich erneut, es wird ein Arbeiter-, Soldaten- und Bauernrat gewählt, Waffen werden verteilt, die öffentlichen Gebäude der Stadt besetzt. König Ludwig III. flieht mit Familie und Entourage aus der Stadt, in der Nacht wird der Landtag besetzt. Eisner ruft sich zum provisorischen Ministerpräsidenten aus und erklärt Bayern zum Freistaat.
Ebenfalls am 7. November besucht Thomas Mann mit seiner Frau Hans Pfitzners Oper Palestrina. Man beschließt den Abend im Beisein des Komponisten, des Dirigenten Bruno Walter sowie Walter Braunfels, der schon mit einigen modernen Kompositionen auf sich aufmerksam gemacht hatte. Revolution? Welche Revolution?
In den nächsten Tagen und Wochen werden Versammlungen abgehalten, Ministerposten besetzt, es soll eine Struktur entstehen, die der revolutionären Politik Rechnung trägt. Selbst die Sozialdemokraten werden berücksichtigt, die sich doch so vehement gegen Räte und Revolution ausgesprochen haben.
Am 17. November findet im Nationaltheater eine Revolutionsfeier statt. Beethovens Leonoren-Ouvertüre wird von Bruno Walter dirigiert, Eisner spricht in einer mitreißenden Rede von der neuen Welt, deren Keimzelle gerade in München am entstehen ist. Permanente und direkte Demokratie, realisiert durch das Rätesystem, soll das Volk zum unmittelbaren Machthaber, zum Gestalter des politischen und gesellschaftlichen Lebens erheben.
Am 25. November reist Eisner nach Berlin zum Treffen der deutschen Ministerpräsidenten. Er erfährt dort keine Unterstützung für seinen Plan, die deutsche Kriegsschuld einzugestehen, auch um die Sieger kompromissbereit für die folgenden Friedensverhandlungen zu machen.
Aber auch in München verliert er zunehmend den Rückhalt bei seinen ehemaligen Verbündeten, die ihre eigenen Pläne verfolgen. Die Stimmung gegen ihn wird aggressiver, die Lage ist gereizt. Als es während einer Demonstration von einigen tausend Arbeitslosen zu Tätlichkeiten kommt, lässt Eisner einige seiner ehemaligen Mitstreiter verhaften. Die Einheit der Linken ist spätestes jetzt zerstört.
Für den 12. Januar sind Wahlen für den Landtag angesetzt, Eisners USPD erreicht 2,5%, die SPD kommt auf 33%, die konservative Bayrische Volkspartei erreicht 35%. Ein Desaster, Eisner ist gescheitert. Aber bis zur konstituierenden Sitzung des Landtags am 21. Februar 1919 wird er im Amt bleiben.
Eisner reist nach Berlin zur Internationalen Sozialistenkonferenz. Dort prangert er die Sozialdemokraten als Kriegsbefürworter an, erklärt erneut die deutsche Kriegsschuld und bietet Frankreich den Einsatz deutscher Freiwilliger an, die die Schäden des Krieges beseitigen helfen sollen. Die nationale Presse schäumt, Eisner wird zum Ziel von Hasskampagnen. Derweil stellt Erhard Auer, der Führer der Mehrheitssozialdemokraten seine Kabinettsliste zusammen. Eisner steht nicht darauf, obwohl sogar der Vorsitzende der Bayrischen Volkspartei einen Ministerposten für ihn gefordert hatte, um eine möglichst breite Unterstützung der neuen Regierung zu erreichen.
Auf dem Weg zum Landtag, in der Tasche seine Rücktrittserklärung, wird Eisner am Morgen des 21. Februar von 2 Kugeln tödlich getroffen. Der Schütze ist Graf von Arco auf Valley [1]. Er selbst wird von Schüssen anwesender Soldaten verletzt, man findet einen Zettel bei ihm, auf dem er seine Motive erklärt: Eisner sei Bolschewist, "er ist Jude. Er ist kein Deutscher. Er verrät das Vaterland..." Im Parlament bricht ein Tumult los, die Nachricht von der Ermordung Eisners verbreitet sich wie ein Lauffeuer in der Stadt, Menschen rotten sich zusammen, wollen Rache für seinen Tod.
Alois Lindner, ein Anhänger Eisners, macht sich auf den Weg zum Parlament. Für ihn ist der Sozialdemokrat Auer wegen seiner konterrevolutionären Haltung verantwortlich für den Tod Eisners, ihn will er zur Rechenschaft ziehen, ihn will er töten. Im Plenarsaal schießt er auf Auer und einige Minister. Auer wird schwer verletzt, zwei Menschen sterben. Lindner kann fliehen [2].
Der Arbeiter- und Soldatenrat tagt in Permanenz, die Regierung gibt es nicht mehr, ein Großteil der Abgeordneten flieht aus München. Ausgangssperre.
Am 26. Februar findet die Beisetzung Eisners statt, 100.000 Menschen geben ihm das letzte Geleit von der Theresienwiese zum Ostfriedhof.
Ab jetzt gibt es zwei Parallelregierungen: Der abwechselnd in Nürnberg und Bamberg tagende Landtag und der in München aktive Zentralrat, der vom SPD-Mann Ernst Niekisch geleitet wird. Die Linke ist zerstritten, die Stadt wird zum Experimentierfeld für alles, was alternativ zur gewohnten Herrschaft ist. Am 6. April treffen sich Vertreter verschiedener linker Gruppierungen mit Ausnahme der Kommunisten und rufen die Räterepublik Bayern aus [3]. Ernst Toller wird Präsident des Zentralrats.
Aber die Kommunisten sind gegen diese Räterepublik und außerhalb Münchens ziehen sich Freicorps zusammen, um den roten Spuk ein Ende zu bereiten. Am 9. April beschließen die Kommunisten das Ende der Räterepublik und stellen eine eigene Regierung auf. In der Stadt herrscht das Chaos, Teile der Republikanischen Schutztruppe laufen zu den Konterrevolutionären über, Erich Mühsam, der keine politische Funktion innehat, aber als Anarchist und Jude den Hass der Reaktion auf sich gezogen hatte, wird verhaftet und später zu 15 Jahren Festungshaft verurteilt werden. Der Zentralrat wird für abgesetzt erklärt, die SPD unterstützt die Putschisten und die Bamberger Exilregierung.
Auf den Straßen wird gekämpft, die Putschisten werden vertrieben, ein neuer Zentralrat aufgestellt. Dieses Mal mit Unterstützung der Kommunisten, die nach und nach die wichtigsten politischen Ämter besetzen. Zur Verteidigung der Stadt soll eine Rote Armee aufgebaut werden.
Immer mehr Menschen sind des politischen Chaos überdrüssig, Unmut wird laut, häufig hört man inzwischen auch antisemitische Töne. Völkische Organisationen wie die Thule-Gesellschaft wittern ihre Chance. Am 26. April werden einige ihrer Mitglieder verhaftet. Freicorps und Truppen der Reichsregierung ziehen den Gürtel um München immer enger.
In der Nacht vom 30. April zum 1. Mai werden insgesamt 10 gefangene Weißgardisten und Mitglieder der Thule-Gesellschaft von Rotgardisten erschossen. Am 1. Mai marschieren die Freicorps in München ein, und es beginnt ein Rachefeldzug ohnegleichen. Gegen Kommunisten, gegen Juden, gegen alle, die im Verdacht stehen mit der Räterepublik zu tun gehabt zu haben. Sie werden gejagt, geschlagen, erschossen. Der reine Verdacht reicht aus. Am 2. Mai wird Gustav Landauer, der in der Räterepublik Beauftragter für Volksaufklärung gewesen ist, in seinem Versteck verhaftet und wenig später in Stadelheim erschossen. Es ist die Stunde, nein, es sind die Tage der Denunzianten. Hunderte verlieren in diesen Tagen ihr Leben, sie werden auf dem Münchner Ostfriedhof in langen Reihen gezeigt, um Verwandten und Freunden die Identifizierung zu ermöglichen.
Im Juni findet der Prozess gegen den Kommunistenführer Eugen Leviné statt, er wird erwartungsgemäß verurteilt und gleich anschließend standrechtlich erschossen. Ernst Toller kann sich über einen Monat in München verbergen bevor er verhaftet wird. Er verbringt seine Haft im selben Gefängnis wie der Attentäter Graf Arco, der allerdings weit vor ihm wieder entlassen wird.
Ein Nachwort widmet Weidermann Carlos Gesell, dem Sohn Silvio Gesells, der während der Räterepublik eine Art Finanzminister gewesen ist. Carlos Gesell gründete in Argentinien die Villa Gesell, ein Ort, in dem heute 30.000 Menschen leben. Außerdem gibt Weidermann eine Übersicht über die weiteren Lebenswege einiger Beteiligter am Geschehen während dieser turbulenten Zeit.
Thomas Mann kommt nicht gut weg in den Schilderungen Weidermanns, die ihn als wankelmütigen Charakter darstellen, der an einem Tag den radikalen Neuerungsprozess begrüßt, um ihn am nächsten mit harschen Worten zu verdammen [4]. Zitiert werden zudem einige antisemitische Äußerungen Thomas Manns [5].
Adolf Hitler wird als Mitläufer beschrieben, der noch zur Beisetzung Eisners mit roter Armbinde in der Funktion eines stellvertretenden Bataillonsrats im Trauerzug gesehen wird. Erst nach der Niederlage der Republik dient er sich den neuen Machthabern als Denunziant an.
Keineswegs als Träumer, wie der Titel des Buches lautet, sondern durchweg als egozentrische Spinner werden die Protagonisten der Räterepublik charakterisiert. Vorneweg Erich Mühsam und Gustav Landauer. Dabei stützt sich Weidermann in langen Passagen auf die Erinnerungen Oskar Maria Grafs (Wir sind Gefangene), die in ihrer selbstironischen Attitüde sehr lesenswert sind, als historische Quelle aber kaum geeignet ist. Ähnliches gilt für Ben Hecht, der als Korrespondent nach München gekommen war, bis dahin eher als Klatschreporter tätig gewesen ist und kaum ein Wort Deutsch verstand. Mit Sympathie werden hingegen Eisner und Toller dargestellt, mehr Getriebene als Handelnde, die sich und ihre Möglichkeiten einfach überschätzt haben.
Der beschriebene Opernbesuch Thomas Manns am 7. November wäre allerdings dazu angetan gewesen, die verschiedenen Wege aufzuzeigen, die Intellektuelle in diesen und den folgenden Jahren eingeschlagen haben bzw. einschlagen mussten:
Thomas Mann, nach dem 1. Weltkrieg konservativ und mit nicht wenigen antisemitischen Ressentiments behaftet, wandelte sich im Exil zum aufrechten Gegner Hitlers und überzeugten Demokraten.
Hans Pfitzner, der sich selbst in der Nachfolge Richard Wagners sah, hegte Sympathien für den Nationalsozialismus, noch Ende 1944 komponierte er eine Hommage an seinen Freund Hans Frank [6], der später wegen Kriegsverbrechen zum Tode verurteilt und hingerichtet worden ist.
Bruno Walter musste Deutschland und Österreich seiner jüdischen Herkunft wegen verlassen.
Walter Braunfels wurde als "Halbjude" nach 1933 all seiner Ämter enthoben, seine Kompositionen durften nicht mehr aufgeführt werden.
Kurt Eisner * 1867 in Berlin. Veröffentlichte als Mitglied der SPD monarchiekritische Artikel, Mitglied der Vorwärts-Redaktion. Verliess 1917 aus Protest gegen die sozialdemokratische Politik während des Krieges die SPD und trat der neu gegründeten Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei Deutschlands bei. War Mitorganisator der Streiks im Januar 1918, die sich gegen den Krieg richteten, und wurde daraufhin für mehrere Monate in Haft genommen. |
----------------------------
1. Arcos Mutter war Jüdin, weswegen er nicht Mitglied in der Thule-Gesellschaft werden konnte.
2. Lindner flüchtet nach Ungarn, wird aber noch im selben Jahr ausgeliefert und zu 14 Jahren Zuchthaus verurteilt. 1928 durch eine Amnestie frei gekommen. Emigrierte Anfang der 30er Jahre in die Sowjetunion, ab 1943 ist sein Schicksal unbekannt.
3. Was bereits in anderen Städten geschehen war: Aschaffenburg, Augsburg, Fürth, Hof, Lindau, Würzburg.
4. "Den vorläufigen Sturz der Räte-Regierung begrüße ich. Den Glauben, daß sie wiederkommt, daß 'es' unaufhaltsam ist, trifft man überall, u. ich teile ihn in hohem Grade. Aber zwischen Theorie und Praxis ist hier ein großer Unterschied, und ich hasse die verantwortungslosen Verwirklicher, die den Geist kompromittieren, wie die Burschen, die für diesmal abgewirtschaftet haben. Ich hätte nichts dagegen, wenn man sie als Schädlinge erschösse, was man aber zu thun sich hüten wird." S. 203
5. "München, wie Bayern, regiert von jüdischen Literaten. Wie lange wird es sich das gefallen lassen?" S. 50
"Wir sprachen auch von dem Typus des russischen Juden, des Führers der Weltbewegung, dieser sprengstoffhaften Mischung aus jüdischen Intellektual-Radikalismus und slawischer Christus-Schwärmerei. Eine Welt, die noch Selbsterhaltungsinstinkt besitzt, muß mit aller aufbietbarer Energie und standrechtlicher Kürze gegen diesen Menschenschlag vorgehen." S. 260f
6. Während des Krieges "Generalgouverneur für die besetzten polnischen Gebiete" und mitverantwortlich für die Ermordung Hunderttausender Polen.
----------------------------
5. Oktober 2020